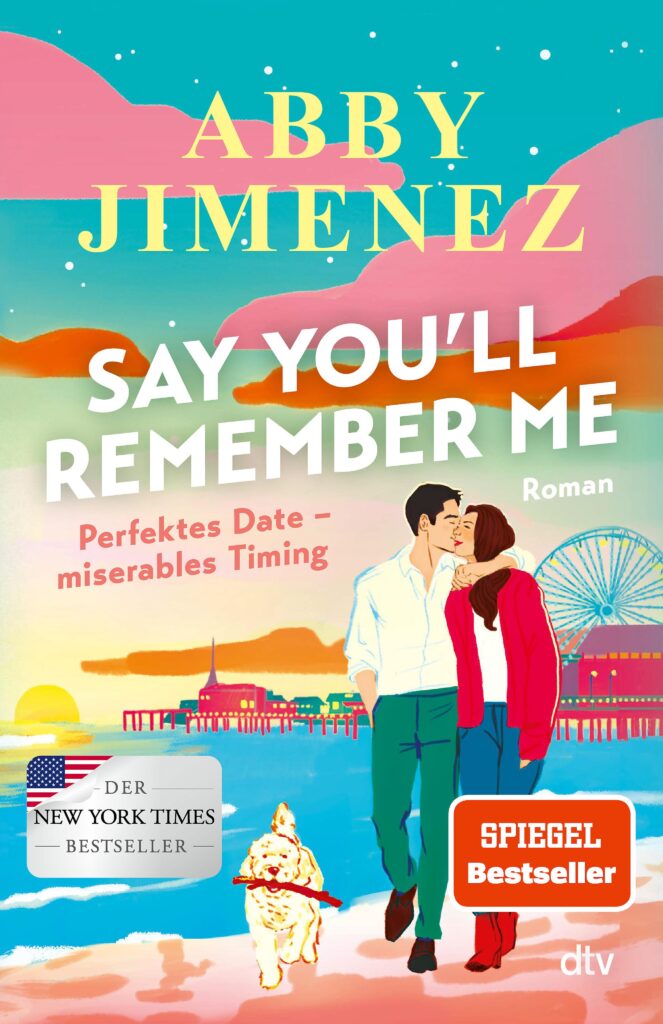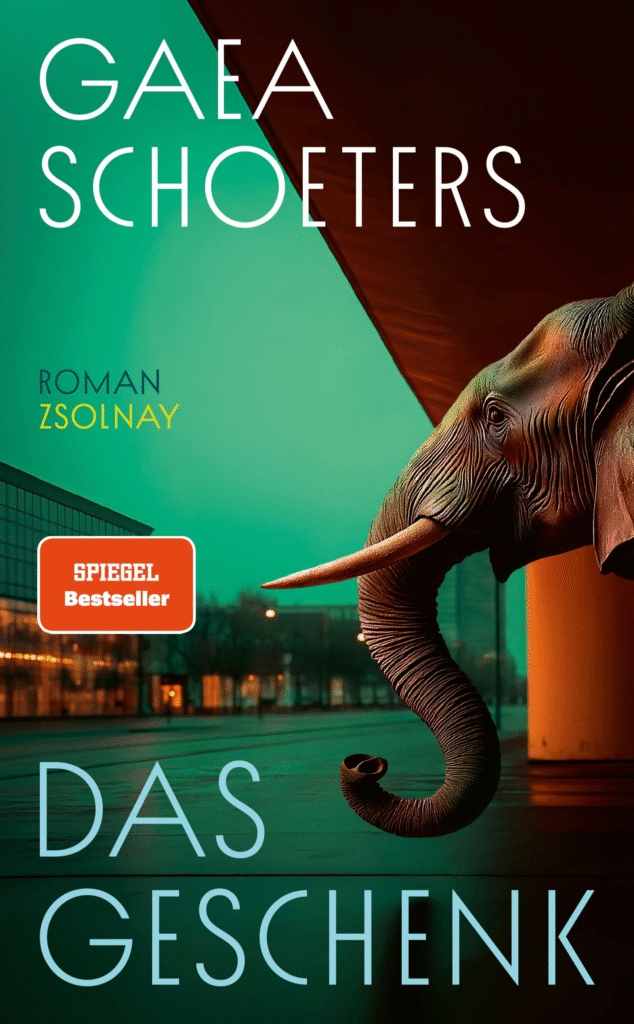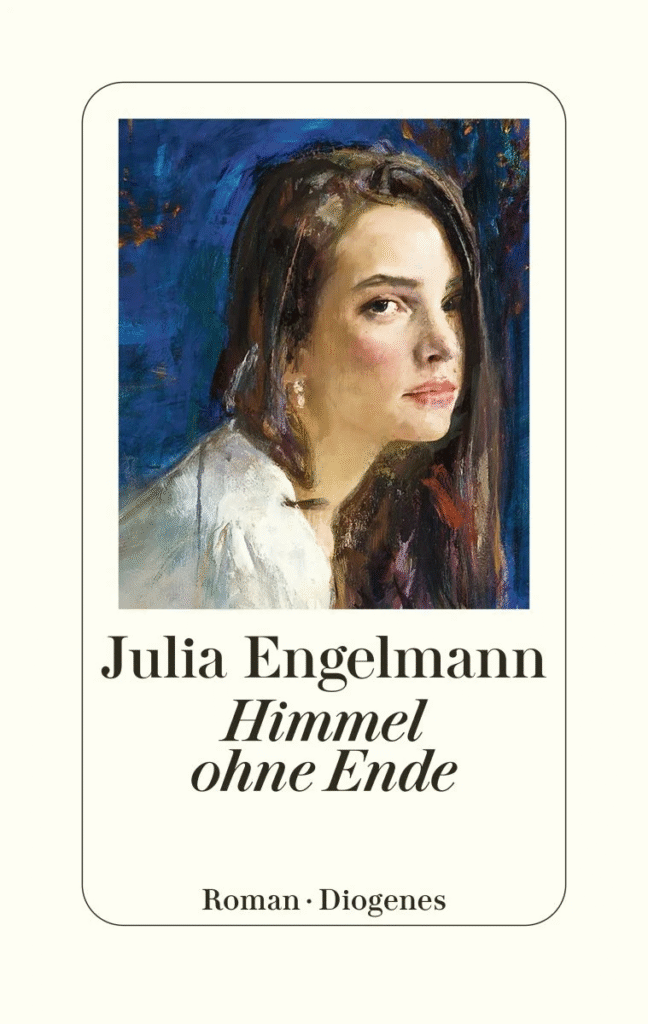20. November 2025
Eine Liebesgeschichte, die dort ansetzt, wo viele Romane enden würden: Im echten Leben, zwischen Verpflichtungen, Unsicherheiten und der Frage, wie viel eine Beziehung tragen kann…
23. Oktober 2025
Es ist ein gewöhnlicher Tag in Berlin, bis eine Horde Elefanten die Stadt flutet und das Chaos ausbricht. Nachdem die Einfuhr von Elfenbein nach Deutschland verboten wird, leidet Botswana unter einem…
25. September 2025
Charlie fühlt sich, als würde sie hinter einer unsichtbaren Scheibe leben – dabei sein, aber nie dazugehören. Die Fünfzehnjährige träumt, schweigt und verliebt sich unglücklich in ihren Mitschüler…
28. August 2025
Kristina Ohlsson wird für ihre interessanten Romanfiguren und die wunderschöne Kulisse gelobt, vor der sich die Verbrechen in der Krimiserie um die Polizistin Maria Martinsson und den…
24. Juli 2025
Im Buch «Das Schwarz an den Händen meines Vaters» schildert Lena Schätte eindrucksvoll das Aufwachsen in einer Familie, die von Alkoholismus und Sprachlosigkeit geprägt ist. Im Zentrum steht die…
26. Juni 2025
Doris Büchel, bisher bekannt als Journalistin und Autorin von biografischen Reportagen, offenbart in ihrem Buch «Wie lange ist nie mehr» ihr Innerstes. Sie schreibt über Endlichkeit und Verlust, aber…
22. Mai 2025
«Elise lehnt sich zurück und starrt auf das Buch. Das ist es, sagt sie sich. Anhand ihrer Aufzeichnungen wird sie auf ihr Leben zurückschauen und herausfinden, wie alles so weit hatte kommen können…
24. April 2025
«Zu allen Zeiten hat es Frauen gegeben, die den Gegenbeweis lieferten für die Theorie des Mannes vom schwachen Geschlecht – von solchen Frauen handelt dieses Buch», schreibt die Historikerin Alexandra…
27. März 2025
Es gibt nichts Neues unter der Sonne? Wolf Haas beweist das Gegenteil…